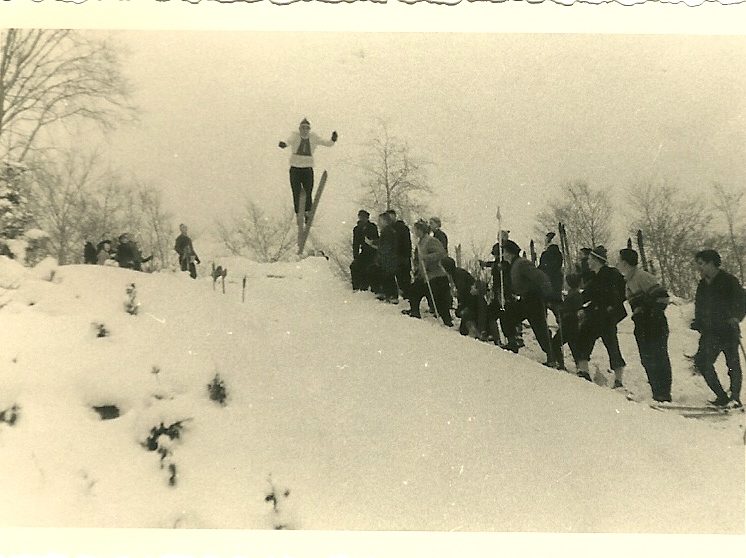AUFGESCHRIEBEN IM HÜTTENRÖDER PLATTDEUTSCH IM NOVEMBER 2005 VON ERNA KÄTZEL – nach einer Vorlage von Peter Gehlmann.
Übersetzung unten
Et war mal vor velen, velen Jahrn, da arjaw et sek, dat en Schwieneharte met siener Rotte jenau ahne Grenze twischen Hiddenrohe un Ellijerohe en Futterhalt henstellte. Dabie stuke ahner siener Schwartkittel ob en metallischen Jejenstand, der sek denne als ne golne Glocke arwies.
Ganz in dar Nähe halten sek Burn ut Hiddenrohe un Ellijerohe op, dei natierlich glieks Ahnspruch op den golnen Fund ahnmeldeten. Doch man worde sek nich einig. Un so kamen alle ewerein, dat de Entschaidung ahn andern Morjen um sesse Uhrtied falln soll. Jesecht, jedan – de Schwieneharte blew tau Bewachung bie de Glocke.
De Hiddenreher dräpen ahn nächsten Morjen met ehn Jespann ganz pinktlich ahn de Fundstelle in. Von den Ellijerehern awer wiet un braht nischt de sahn. Se harrn ganz einfach vorschlapen. So luden de Hiddenreher dän goldnen Schatz op ehren Wagen un makten sek frohen Muts Richtung Hamat davon.
Pletzlich sahnse op den wieden Felle enne mächtige Stofwolke, de Ellijereher kahm in dullen Trawe met ehren Jespann immer näher. Sau mossten ok de Hiddenreher dat Tempo arhehen.
Doch da passierte et, op den holpriegen Wäje en Splint ahn rechten Hinderrad drohte ut derutschen. Dä erfolgrieke Hamreise war op dat argste jefährdet. Doch klauk wie de Hiddenreher schon immer warn, stekte aner von den ehren siehnen Duhm in dat Lock un verhinderte damet dähn Vorlust det Hinderrads.
In wilder Jacht jing et Richtung Hiddenrohe – de Ellijereher awer kamen immer näher. Met letzter Kraft awer areckten de Hiddenreher ehr Hamatdorp, in den se von de freudigen Inwohner begastert in Empfang enommen worn.
De Hiddenreher awer, der mot sienen uhm dat Rad ahn Rullen ne holen harre, mosste schmarzhaft dän Verlust sienet Duhms, wie de Hiddenreher in ehren plattdietschen Dialekt sehn, tau Kenntnis nehm. Et blew blos en Stumpel.
Saht disser Tiet heten de Hiddenreher in Volksmuhle de Stumpelduhms.
De Ellijereher mossten wutentbrannt de Hamrase ohne de golne Glocke ahnträn – un da se die Tiet vorschlapen harrn, rapten ehnen de Hiddenreher hinderher: jie Langeschläper.
Saht disser Tiet wärn alle Ellijereher Langeschläper renennt.
De Hidderreher awer feierten en grotes Fest. Se sind noch hiete en Velkchen, dat vehle Feste fiehert. In Sommer rohkt et fast ahn jedn Wochenenne.
De Orts-Chronisten hem disse Jeschichte oppeschrehm.
Un ahn manchen Senndagen berichtet de Hiddenreher Stumpelduhm ewer dat Jeschehen in Dorpe.
De Ellijereher awer erfahrn dat erscht veel späder, denn se sind ja de Langeschläper.
Wu awer de Glocke blem ist, weiht blos ahner, Jiher Hiddenreher Stumpelduhm
Es war einmal vor vielen, vielen Jahren, da ergab es sich, dass ein Schweinehirt in den Abendstunden eines lauen Sommertages mit seiner Rotte genau an der Grenze zwischen Hüttenrode und Elbingerode einen Futterhalt einlegte. Dabei stieß einer seiner Schwarzkittel auf einen metallischen Gegenstand, der sich dann als eine goldene Glocke erwies.
Ganz in der Nähe hielten sich Bauern aus Hüttenrode und aus Elbingerode auf, die natürlich sofort Anspruch auf den goldenen Fund anmeldeten. Doch man wurde sich nicht einig und so kamen alle überein, dass die Entscheidung am kommenden Morgen um sechs Uhr fallen sollte, wem wohl die Glocke künftig gehören würde. Gesagt, getan … der Schweinehirt blieb zur Bewachung bei der Glocke.
Die Hüttenröder trafen am nächsten Morgen mit einem Gespann ganz pünktlich an der Fundstelle ein, von den Elbingerödern aber war weit und breit nichts zu sehen. Sie hatten ganz einfach verschlafen. So luden die Hüttenröder den goldenen Schatz auf ihren Wagen und machten sich frohen Mutes Richtung Heimat davon.
Plötzlich sahen sie auf dem weiten Feld eine mächtige Staubwolke, die Elbingeröder kamen in tollem Trab mit ihrem Gespann immer näher. So mussten auch die Hüttenröder das Tempo erhöhen.
Doch da passierte es auf dem holprigen Weg. Ein Splint am rechten Hinterrad drohte rauszurutschen, die erfolgreiche Heimreise war auf das Ärgste gefährdet. Doch klug wie die Hüttenröder schon immer waren, steckte einer der Ihren seinen Daumen in das Loch und verhinderte damit den Verlust des Hinterrades.
In wilder Jagd ging es Richtung Hüttenrode – die Elbingeröder aber kamen immer näher. Mit letzter Kraft jedoch erreichten die Hüttenröder ihr Heimatdorf, in dem sie von der freudigen Einwohnerschaft begeistert empfangen wurden.
Der Hüttenröder aber, der mit seinem Daumen das Rad am Rollen gehalten hatte, musste schmerzhaft den Verlust seines Daumens, des Duhms, wie die Hüttenröder in ihrem plattdeutschen Dialekt sagen, zur Kenntnis nehmen. Es blieb nur ein Stumpel – seit dieser Zeit heißen die Hüttenröder im Volksmund die Stumpelduhm. Die Elbingeröder mussten wutentbrannt die Heimreise ohne die goldene Glocke antreten – und da sie die Zeit verschlafen hatten, riefen ihnen die Hüttenröder hinterher: Ihr Langeschläfer – auf plattdeutsch: Langeschläper. Seit dieser Zeit werden alle Elbingeröder Langeschläper genannt.
Die Hüttenröder aber feierten ein großes Fest. Sie sind noch heute ein Völkchen, dass viele Feste feiert. Im Sommer raucht es fast an jedem Wochenende!!
Die Orts-Chronisten haben diese Geschichte aufgeschrieben – und an manchem Sonntag berichtet der Hüttenröder Stumpelduhm über das Geschehen im Dorf. Die Elbingeröder aber erfahren es erst viel später – denn sie sind ja die Langeschläper.
Wo aber die Glocke geblieben ist, weiß nur einer …
Euer Hüttenröder Stumpelduhm!!